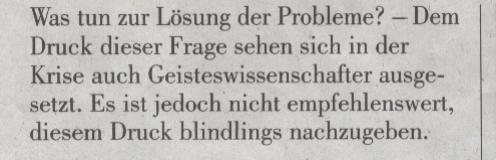Besprechung des Feuilleton-Beitrags aus der NZZ vom 31.10.2009 „Die Ratlosigkeit des Moments“. Hans Ulrich Gumbrecht macht sich Gedanken über die Position der Geisteswissenschaften und über ihren Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. Dabei geht er aus von dem Sinnspruch der Antike aus, dass in Kriegszeiten die Texte schweigen („In armis silent litterae“), zum einen, weil die Männer Dienst an der Waffe tun müssen, zum anderen, weil die Not die Inspiration versagt.
Vor diesem Hintergrund beleuchtet er die Dichtergeneration von Georg Trakl, Ernst Jünger und Louis-Ferdinand Céline, die doch noch während des Ersten Weltkrieges die Kultur weiterentwickelt und bereichert hat. Darauf bezieht sich Heidegger, der nach dem Zweiten Weltkrieg das Hölderlinsche Wort aus Strophe sieben der Elegie „Brod und Wein“ aufgreift: „…was zu thun indeß und zu sagen, / Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit“. Als „ratlos“ bezeichnet Autor Gumbrecht unsere Gesellschaft, in Bezug auf die Gründe Heideggers, diese Frage neu zu stellen, als auch in Bezug auf die Frage, was Dichter seit dem 20. Jahrhundert zur Überwindung und Vermeidung von Krisen beigetragen hätten.
Erst im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass er nicht allgemein eine moralische oder kulturelle Krise meint, sondern hier ganz konkret die Kreditkrise anspricht. Weder würden ihr „Kleinmütige“ gerecht (die Geisteswissenschaften als Luxusveranstaltung missverstehen oder die das Ausbleiben von Forschungsgeldern fürchten) noch jene „beamteten Denker, die sich – wie altkluge Kinder – anmassen über Lösungen zu verfügen“. Wenn dann von moralischen Ursachen wie Gier oder Profitmentalität gesprochen würde, sei die „Grenze des Grotesken“ erreicht.
Bei der Suche nach Antworten erscheint es dem Autoren „evident“, dass Geisteswissenschaftler „die Absenz von Antworten auf unsere dringendsten Fragen nicht nur einzugestehen, sondern zu thematisieren und in ihren Folgen abzuschätzen.“ Das könne sich die Wissenschaft durchaus leisten, meint Hans Ulrich Gumbrecht und wird gleichzeitig seiner eigenen Forderung gerecht, indem er das Fehlen der Antworten thematisiert. Daraufhin wendet er sich wieder Heidegger zu, der im „Humanismusbrief“ und dann im Aufsatz „Wozu Dichter?“ (beide 1946) das Sich-Eingestehen der eigenen Ratlosigkeit als den Mut beschrieben hat, „sich der Erfahrung des Abgrunds auszusetzen“.
Grundsätzlich ist diese „Denkbewegung“ sicherlich allemal angemessener, als in „irreversibler Blindheit“ den „ungedeckten Anspruch“ zu erheben, „über Lösungen zu verfügen“. Es geht ihm darum, dem „manchmal ja beinahe terroristischen Drängen der Kollegen und der Gesellschaft auf >>konstruktive Kritik<< nicht immer gleich nachzugeben.“ Sicher erweisen sich viele angebliche Lösungen als „Rohrkrepierer“. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum die Geisteswissenschaftler erst dann einen Ort in der Gesellschaft gefunden haben, „wenn pessimistisch sein, skeptisch sein und realistisch sein wieder konvergieren dürfen.“
Möglicherweise bezieht sich die geäußerte Kritik aktuell auf die Sloterdijk–Honneth–Debatte, über deren Ursachen Richard David Precht im Spiegel geschrieben hat: „immer mehr Schärfe im Einzelnen auf Kosten einer zunehmenden Gleichgültigkeit im Ganzen.“ Ich wünsche mir, dass ich als skeptischer Realist auch begründet optimistisch sein kann. Noch mehr wünsche ich mir jedoch, dass einzelne Dichter, die mit Geisteswissenschaftlern nicht zu verwechseln sind, neben Realismus und Skepsis auch der Utopie und der Zuversicht das Wort reden.
Tags: Erfahrung des Abgrunds, Geisteswissenschaften, Hans Ulrich Gumbrecht, Hölderlin, Wozu Dichter in dürftiger Zeit?