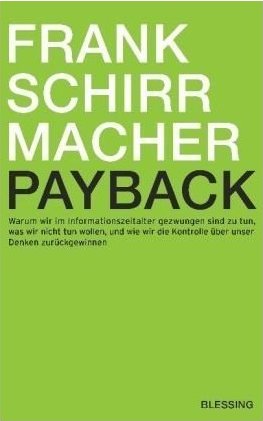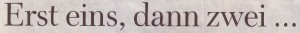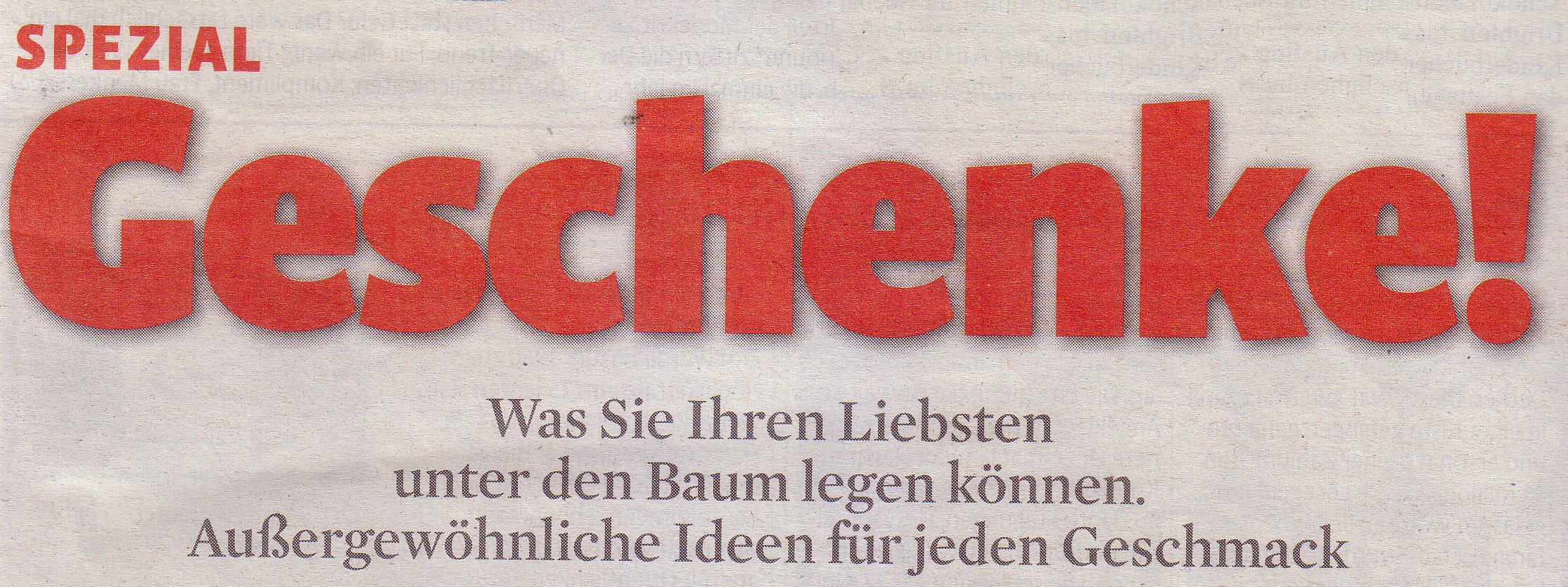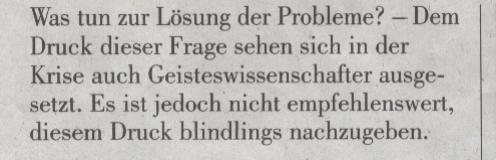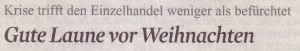Besprechung von Frank Schirrmachers neuem Buch „Payback“ in der Neuen Zürcher Zeitung. „Erschöpftes Ich in Datenfluten„, so lyrisch der Titel des Feuilleton-Artikels, so gehaltvoll seine Ausführung. Dem Autoren Uwe Justus Wenzel gelingt es jeweils in wenigen Sätzen die Position des Mitherausgebers der FAZ klarzumachen („Kulturkritik (…) hält (…) Technikbegeisterung die Waage“, wenngleich der Pessimismus zu überwiegen scheint), Schirrmachers Methode zu erläutern („unter Rückgriff auf neuere Untersuchungen aus Psychologie und Nerurobiologie“ – „Multitasking als Symptom“) als auch den Ursachenhorizont des beschriebenen Phänomens zu beleuchten: „Er macht beiläufig, aber mehr als einmal ein Wunsch-Angst-Gespann verantwortlich für das, was geschieht: den Wunsch nach Kontrolle über unser Leben und die Angst vor Kontrollverlust.“
Demnach spielt sich – in den zu Grunde gelegten Fällen der Technik-Obessivität – eine Spirale des Kontrollverlusts ab: je stärker der Mensch in die Technik investiert, um sein leben zu kontrollieren, umso mehr gibt er die Kontrolle ab. Die Phänomene sind uns gut bekannt: Schon wenn die TV-Fernbedienung nicht mehr geht, wenn der Drucker ausfällt, wenn beim Surfen die Internetverbindung abbricht oder wenn das Navi eine Einbahnstraße nicht als solche gespeichert hat. Natürlich bestehen immer Alternativen, mit diesen Situationen umzugehen. Nur, dieser Zustand der machtlosen Abhängigkeit von der Technik nervt.
Der Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit, sprich wie ich mich in dieser Situation verhalte, liegt meines Erachtens an jedem selbst. Immanuel Kant schrieb 1784 zur „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?„: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ Der Verstand ist der Schlüssel dazu, jedwede Information aus all den verfügbaren Kanälen zu eigenem Wissen zu verarbeiten.
Uwe Justus Wenzel versucht den von Schirrmacher dazu empfohlenen Perspektivwechsel mit einer Utopie zu verdeutlichen, die an Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ angelehnt ist, „in der der Umgang mit Informationen nicht mehr vom nie zu stillenden Hunger geprägt wird, sondern vom Spiel“. Der Rezensent schreibt, dass das Buch „seiner – spielerischen – Machart nach bereits einen Vorgeschmack von ihrer Verwirklichung“ liefert (der der Utopie). Das Spielerische gefällt mir gut, auch wenn wir dabei Spuren im Netz hinterlassen. Heißt das Buch deswegen „Payback“, weil wir „die Rechnung erhalten“ für alles , was wir tun? Andere Spuren im Netz hierzu beim WDR- Jugendsender Eins Live: „Selber Denken!„, „Kein Kommentar“ bei WDR 5 von Uli Höhmann: „Planlos plan und so flat wie die rate“ sowie zahlreiche Rezensionsnotizen bei perlentaucher.de.
Karl Blessing Verlag, München 2009
ISBN-10 389667336X
ISBN-13 9783896673367
Gebunden, 200 Seiten, 17,95 EUR