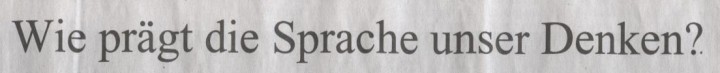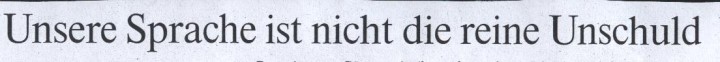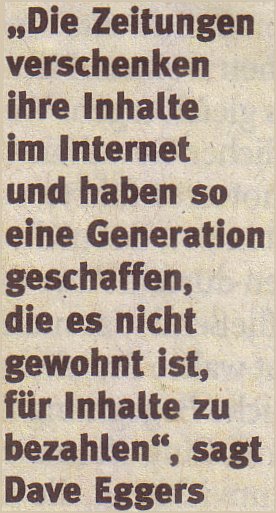Wieder einmal geraten die US-Internetkonzerne Facebook und Google ins Visier der Datenschützer: Google hat beim weltweiten umstrittenen Abfilmen der Straßen auch ungefragt bestehende Funknetze gescannt, Facebook bietet seine Dienste zum Einbinden auf privaten Homepages an.
Googles Vorgehen ist schlicht peinlich, denn andere Unternehmen wie Skyhook Wireless, mit denen Google zusammenarbeitet, erfassen diese Dasten bereits „offiziell“, das heißt als ausgewiesenes Geschäft ohne bisher als illegal zu gelten. Google zerstört dadurch Vertrauen, das sowieso zu großen Teilen nur aus der Bequemlichkeit seiner Nutzer bestehen dürfte. Facebooks Vorgehen dagegen ist raffiniert, indem die Nutzer dem Konzern bereitwillig Daten liefern, auch ohne im sozialen Netzwerk eingeloggt zu sein.
In seinem Kommentar in der Welt bezieht sich Thomas Heuzeroth auf Googles Verhalten – auch angesichts der Kritik an diesem Vorgehen. Der Konzern klagt, dass Kartenherstelelr für Navigationsgeräte aber auch tausende Handyprogramme auf die Wlan-Ortsbestimmungen zugreifen. Die haben sich dabei aber immerhin auf bestehende Verträge gestützt, mögen diese nun aus Gesichtspunkten des Datenschutzes gerechtfertigt erscheinen oder nicht. Der Welt-Autor sieht die Chance: „Dass Google unter Datenschützern zu einem Reizwort geworden ist, muss ja nicht schlecht sein. Damit wird das Unternehmen immer mehr gezwungen, doch bitte so durchsichtig zu sein wie ein Wasserglas.“
Das muss er mir aber bitte einmal erklären. Wer kann denn Google effektiv in die Knie zwingen, so lange die Nutzer seine Dienste weiter unkritisch in Anspruch nehmen? Dies erläutert Thomas Heuzeroth im Artikel vom selben Tage: „Facebook wird im Internet allgegenwärtig„. Am Beispiel von Facebooks Strategiewechsel lässt sich erkennen, was auch Google schon seit Jahren betreibt: Mit dem Programm Google Analytics kann ein Webseitenbetreiber eine Auswertung über die eigenen Besucher erhalten: „Woher sie kommen, was sie klicken, wohin sie gehen und mit welcher Software sie surfen. Und Google erfährt das natürlich auch.“
Im Fall von Facebook betrifft die Einbindung weitere, als nützlich erachtete Dienste wie den „Like-Button“, persönliche Empfehlungen oder die Darstellung der Aktivitäten anderer, befreundeter Nutzer. Die Allgegenwart der Konzerne ist insofern schon fast mit einer „Allmacht“ im Internet gleichzusetzen, zumindest was die Kenntnis über zahlreiche Eckdaten der an diesen Aktionen beteiligten Nutzer betrifft. kein Wunder, dass aufgrund der zunehmenden Bedeutung des mobilen Internets auch die Kenntnis über die bestehenden Funknetze nur ungern anderen überlassen wird.
Allerdings ist in meinen Augen eher der Nutzer, der sich – nicht ganz zwangläufig, aber doch sehr häufig – auf die Dienste dominanten Internetkonzerne einlässt, „Transparent wie ein Wasserglas“, nicht aber Google oder Facebook selbst, die es doch viel eher sein sollten. Die lachen sich eins, wenn sie die Diskussionen um Datenschutz verfolgen. Aber dafür ist mein kleiner Beitrag hier erstens zu unpopulär und zweitens zu wenig fundiert. Die Mittel und Wege zur Durchleuchtung der Nutzer ist, fürchte ich, noch weitaus raffinierter, als sich das der Otto-Normalsurfer vorstellen kann.