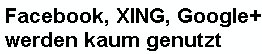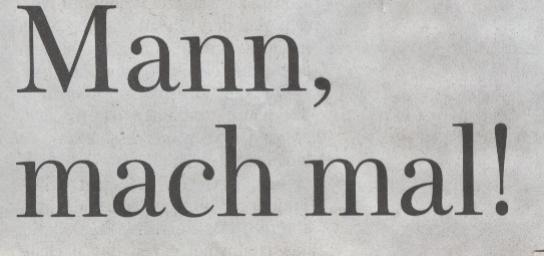Was muss ich da lesen? „Networking-Profis“ haben offenbar viel weniger mit Sozialen Netzwerken zu tun, als sich der Durchschnitts-Dummie so vorstellt. Weder Facebook, wo das „Freunde sammeln“ bis zu dem Punkt führt, dass es einfach mal reicht, noch LinkedIn, das sich als ein weltweiter Business-Club versteht (geschweige denn Xing) hätten auch nur annähernd die Bedeutung, die ihnen im Rahmen von Gegenwarts- und Trendanalysen zum Web 2.0 zugeschrieben werden. Das will die neue Initiative „Dictyonomie“ (= Die Lehre der Netzwerke) herausgefunden haben. Um praktischerweise auf ihrer Homepage direkt auf ein selbstverständlich sehr praxisnahes Werk „Wie man aus Fremden Freunde macht“ hinzuweisen.
Ein rundes halbes Dutzend in den Augen des Initiators Alexander Wolf herausragender Netzwerker werden beschrieben, wobei mir die Auswahl reichlich willkürlich erscheint, möglicherweise beeinflusst durch die zufälligen Bekanntschaftten des eigenen Netzwerks des Absenders. Mit einer Mail hat er mich auf seine Initiative aufmerksam gemacht, wonach eine neue „Dictyonomie“-Studie geringe Relevanz von Social Communities bei Networking-Profis offenbare. Hierzu hat er nach eigenen Angaben Politiker, Unternehmer, Manager und Diplomaten interviewt (etwa jeweils einen?) und eine Umfrage unter 100 Business-Club-Mitgliedern durchgeführt, wie Profis ihre Netzwerke aufbauen und pflegen.
Seine vorab mitgeteilten Ergebnisse klingen durchaus interessant: 1. Social Communities spielen eine wesentlich geringere Rolle als bisher angenommen: Nur ca. 20% der Networking-Profis nutzen sie intensiv für ihre Kontaktpflege. 2. Deutschlands Networker sind eher schüchtern: Nur 49% stufen sich selbst als „sehr kontaktfreudig“ ein. Und 3. große Geschäfte werden immer noch in kleinen Netzwerken gemacht: 91% bevorzugen Geschäfte mit Menschen, die sie gut kennen. Aber liegt das nicht eigentlich alles auf der Hand?
Der Hype ums Netzwerken nervt mich schon lange. Klar kommt es darauf an, wie ich mit Menschen umgehe. Es kommt auch darauf an, welche Ziele ich verfolge, ob ich Menschen instrumentalisiere oder ich sie einfach gerne kennen lernen möchte (geht das – ohne Hintergedanken?). Und große Geschäfte wickle ich bestimmt auch nicht über Facebook ab. Es geht um Vertrauen, das sich aus guter gegenseitiger Kenntnis und Verlässlichkeit ergibt. Aus meiner Sicht sind Netzwerk-Erfolge letztlich Zufälle – soweit es im Leben überhaupt so etwas wie einen Zufall gibt.