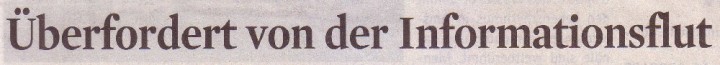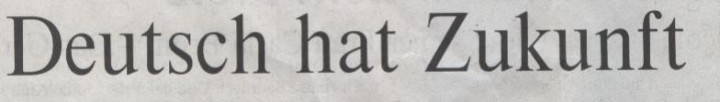Bei dem schwachen Medienecho des 4. Kölner Mediensymposiums fällt die Orientierung vergleichsweise leicht: Lediglich der Kölner Stadt-Anzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung bringen heute einen Nachbericht von der gestrigen Veranstaltung der Landesregierung und der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Beide Artikel hat über weite Strecken wortgleich Thomas Kröter geschrieben. Bekanntlich gehören beide Zeitungen zum Kölner Verlagshaus Neven DuMont Schauberg.
Immerhin weichen die Überschriften voneinander ab, auch sind zwei unterschiedliche Fotos des „Stargastes“ Frank Schirrmacher (FAZ) zu sehen. Über den Autor des Buches „Payback“ (texthilfe.de berichtete) gibt es jedoch nicht viel zu sagen, außer dass er mit seinem „Kulturpesimismus“ die Vorlage für den Philosophen Frank Hartmann von der Bauhaus-Universität in Weimar lieferte: Neue Techniken zwängten den Menschen zur Veränderung. – Dabei fällt mir der Feuervergleich aus dem Vorbericht im Kölner Stadt-Anzeiger wieder ein.
Der Münsteraner Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger verdeutlichte hingegen, dass nach wie vor die klassischen Medien die Themen setzten, auf die sich auch Blogger bezögen(wie etwa der weitere Gast Markus Beckedahl von www.netzpolitik.org). Dennoch, so Thomas Kröter in beiden Artikeln abschließend mit der Medienpädagogin Helga Theunert, stehe neben dem Beherrschen der Technik (das Frank Schirrmacher offenbar schwerer fällt), notwendig das Nachdenken darüber, was das Netz mit den Menschen anstelle. Beim Feuer ist es klar: Es wärmt, kann aber auch alles niederbrennen. Beim Internet hieße die Analogie vielleicht: Es klärt auf, kann aber auch zu totaler Verwirrung führen.