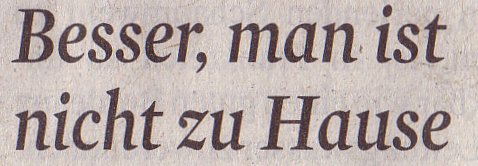Die Aberkennung des diesjährigen Henri-Nannen-Preises in der Kategorie „Reportage“ wirft ein schlechtes Licht auf den Journalismus. René Pfister hatte für seinen Spiegel-Artikel „Am Stellpult“ die Auszeichnung in dieser Kategorie erhalten, obwohl er selbst im darin beschriebenen Hobbykeller von Horst Seehofer nie war. Dieses Veräumnis hatte er in seiner Dankesrede selbst eingestanden, nicht ahnend, dass er damit die Voraussetzung für den Erhalt des Preises nicht erfüllte. Der Sachverhalt wiegt um so schwerer, da die Reportage als wichtigste Preiskategorie gilt.

Treffend, in Bezug auf den Inhalt des fraglichen Beitrags, beschreibt Anne Burgmer heute im Kölner Stadt-Anzeiger den Sachverhalt, der nach ihrer Unterüberschrift „Grundfragen des Journalismus berührt“. Laut Erklärung der Hauptjury erfordert aber die Glaubwürdigkeit einer Reportage, „dass erkennbar ist, ob Schilderungen durch die eigene Beobachtung des Verfassers zustande gekommen sind, oder sich auf eine andere Quelle stützen, die dann benannt werden muss.“ Das Guttenberg-Syndrom scheint hier wieder einmal zugeschlagen zu haben. Nur in einem anderen Zusammenhang.
Am Inhalt des Artikels „Am Stellpult“ gibt es nach Meinung der Jury nichts auszusetzen, nur an der Form. In der Tat sind Reportagen aktuell stark gefragt. Dabei sollen Journalisten von ihren Erfahrungen vor Ort berichten. Wenn sie nicht selbst vor Ort waren, müssen sie darauf hinweisen und nicht in einer Weise formulieren, die den Eindruck vermittelt, als seien sie dagewesen, so die. Denn dann beziehen sie die Eindrücke zweifellos von jemand anderem. Und diese Quelle müssen sie ebenso nennen wie ein Wissenschaftler die in seinen Arbeiten zitierten Quellen.
Der Spiegel selbst nahm die Entscheidung in einer Erklärung „mit Unverständnis zur Kenntnis“, weder sei René Pfister um eine Stellungnahme gebeten worden, noch habe René Pfister an irgend einer Stelle behauptet, selbst im Keller gewesen zu sein. Vielmehr habe er die Angaben aus „Gesprächen mit Seehofer, dessen Mitarbeitern sowie Spiegel-Kollegen, die den Hobbykeller selbst in Augenschein genommen haben“.
Hinzu kommt, dass es sich bei dem Artikel eigentlich nicht vorrangig um eine Reportage handelt, sondern eher um eine „szenische Rekonstruktion“ wie der Spiegel meint. Oder um ein „analsyiserendes Portät“, wie Anne Burgmer schreibt und schlussfolgert, die Jury des Henri-Nannen-Preises müsse sich fragen, „warum sie Pfisters Stück überhaupt in ihre Betrachtung einbezogen hat“. Kernfrage dürfte nun sein, ob die Aussage der Spiegel-Erwiderung stimmt: „Jede Reportage besteht nicht nur aus Erlebtem, sondern auch aus Erfragtem und Gelesenem.“
Zum einen ist die Frage, ob die Grundprinzipien der Reportage: Konkretisierung, Nähe, Emotionalität und eben Unmittelbarkeit sich auch aus Aussagen Dritter speisen lassen? Immerhin ist ein gebräuchliches Synonym von Reportage „Augenzeugenbericht“. Zum anderen erscheint die Frage erlaubt, ob die Mehrzahl der Journalisten den Zeitaufwand überhaupt leisten kann, sich für die häufig gefragten Reportagen ein eigenes Bild vor Ort zu machen.
Dies soll keine Entschuldigung für nachlässiges Arbeiten sein, sondern ein Appell für angemessene Bezahlung. Denn nicht nur Reportagen, sondern auch Interviews entstehen inzwischen häufig „mittelbar“, über Ecken, sprich über die Aussagen Prominenter in anderen Medien.