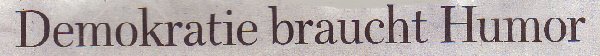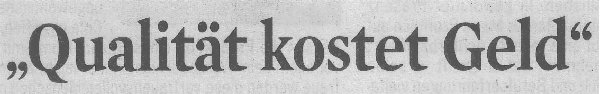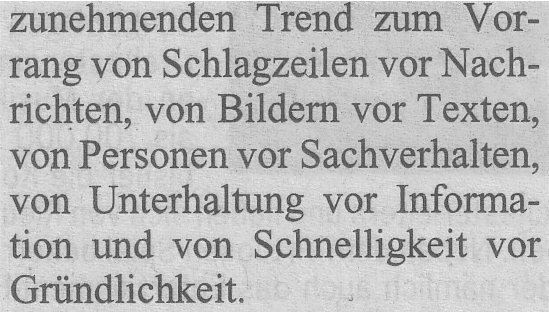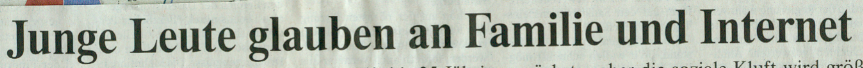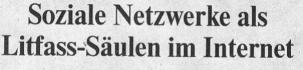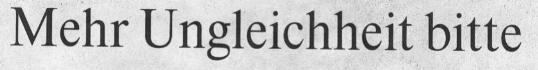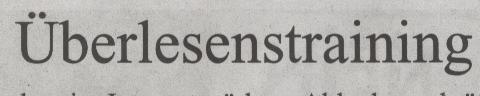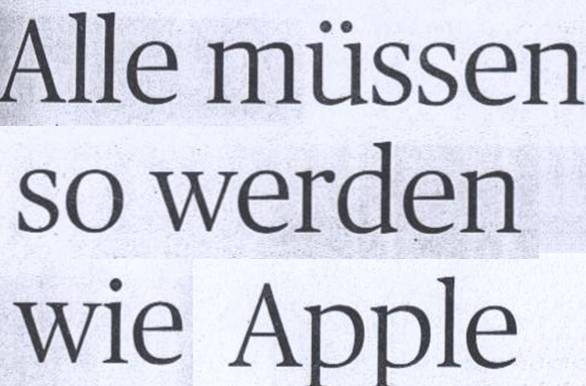Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) hat in Essen seinen diesjährigen Zeitungskongress unter dem Motto „Die digitale Revolution und die Zeitung“ durchgeführt. Mehr als 500 teils hochkarätige Gäste waren zu der Veranstaltung geladen, neben BDZV-Präsident Helmut Heinen alleine beim Podiumsgespräch „Der Preis des Internets“, moderiert von Frank Plasberg, der ARD-Vorsitzende Peter Boudgoust, die Online-Journalistin Mercedes Bunz, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG Matthias Döpfner, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Frank Schirrmacher und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Max Stadler.
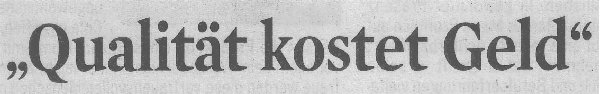
Im Kölner Stadt-Anzeiger wurde der erste Tag unter obiger Überschrift zusammengefasst (online leider nicht verfügbar). „Nicht viel Neues“, war ich aufgrund der Schlagzeile geneigt zu glauben. Diesem Credo folgend plädierte zunächst BDZV-Präsident Heinen an die regionale Stärke der Tageszeitungen, wiewohl aus deren ausgebauten Internetpräsenzen noch immer keine Erlöse zu erwarten seien. „Zeitungen sind der Kitt unserer Gesellschaft„, sagte Helmut Heinen, um daraus abzuleiten, dass sie eigentlich mehrwertsteuerfrei erscheinen müssten. Zum Verlauf der weiteren Diskussion über die geplanten ARD-Apps zwischen Mathias Döpfner („gebührenfinanzierte digitale Gratiszeitungen“) und Peter Boudgoust („gesellschaftlicher Auftrag der Meinungsbildung auf allen elektronischen Wegen“) siehe z.B. Horizont.net. Noch spannender jedoch fand ich die im Kölner Stadt-Anzeiger zitierten Bemerkungen des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU) zu elektronischen Medien, die „die Rahmenbedingungen für die Printmedien“ dominierten. Er konstatierte einen…
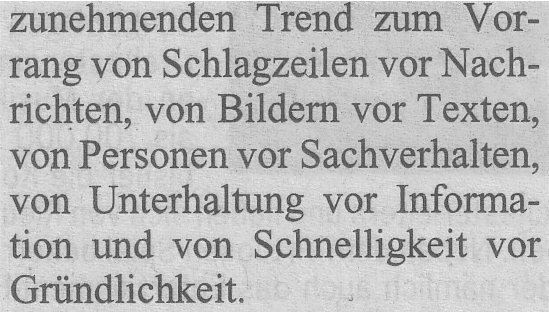
Das sind eher Tendenzen des Boulevards, die durch die Echtzeit-Möglichkeiten des Internets vielleicht noch unterstützt werden. Doch dominieren in meinen Augen elektronische Meiden Printmeiden keineswegs, gerade wenn es um Qualität geht! Dennoch würden Tageszeitungen, so Norbert Lammert weiter („systemrelevant für die Demokratie“ als Stichwort für Helmut Heinen), ein „komplexes und analytisches Informationsangebot“ bieten, gegenüber den Inhalten im Internet, die eher spezielle Interessen der Nutzer bedienten.
Die Leistungsmerkmale der Zeitungsbranche können sich fraglos dennoch sehen lassen (vgl. den letzten Absatz im obigen Link zum BDZV vom 20.09., „Kitt unserer Gesellschaft“): 20 Millionen täglich abgesetzte Zeitungen in Deutschland werden von rund 49 Millionen Menschen gelesen, das entpricht einer Reichweite von knapp 70 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren, mit Spitzenwerten bei Gutverdienenden (72,8 Prozent) und Gutausgebildeten (75,8 Prozent). Mehr als die Hälfte aller Internetnutzer greift regelmäßig auf Online-Zeitungsangebote zu. Da sehe ich keine allgemeine Krise, sondern eher Anpassungsschwierigkeiten im Einzelnen, rund um das altbekannte Problem des Bezahlinhalts („Paid Content“).

Dass der BDZV nun eine neue Gesellschaft gründet namens „Jule – Initiative junge Leser“, ist zwar verständlich, klingt aber wenig erfolgversprechend. Immerhin greifen immer noch die Hälfte aller Jugendlichen und jungen Leute, für die das Internet eine sehr große Bedeutung hat, zur gedruckten Information. Aus der Erkenntnis heraus, dass „Kinder und Jugendliche heute nicht mehr automatisch zu Zeitungslesern“ werden (so BDZV-Vizepräsident Hans-Georg Schnücker im Kölner Stadt-Anzeiger, online leider nicht verfügbar), sollen nun „effiziente Maßnahmen zur Gewinnung neuer junger Leser“ identiziert werden.
Aber wurden Kinder und Jugendliche früher allesamt „automatisch zu Zeitungslesern“? Das wage ich zu bezweifeln. Das hat nicht nur etwas mit dem wachsenden Internetzugang, sondern vielmehr mit dem gelebten Vorbild im Elternhaus zu tun. Die Zeitungen (grob verallgemeinert) müssen in ihrer Aufmachung belebter und ihren Texten frischer sein und das Internet endlich als Bereicherung ihrer eigenen Möglichkeiten erkennen und behandeln.