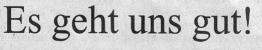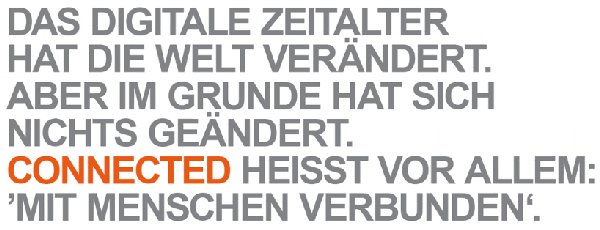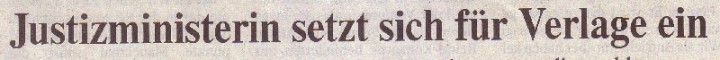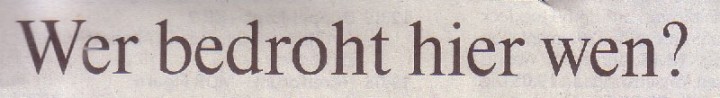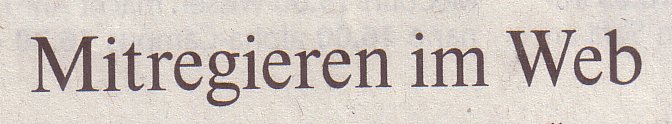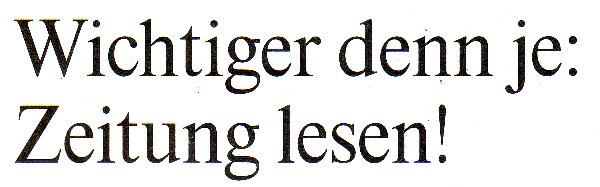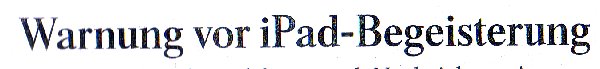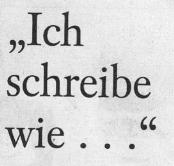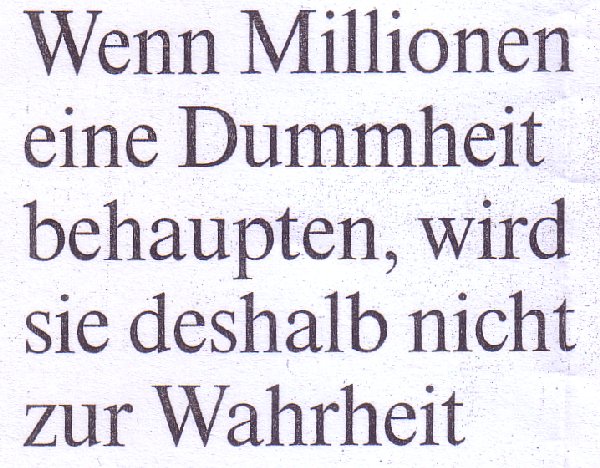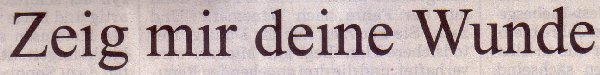Diese Meldung hat mich kurz vor Beginn der Normalzeit noch einmal hellwach gerüttelt: Drogen zerstören Netzwerke im Gehirn, schreibt unter anderem die Welt unter Berufung auf eine Studie der Universität Rostock. Dabei hat eine Forschergruppe um den Rechtsmediziner Andreas Büttner systematisch die Gehirne Drogentoter untersucht und eine vorzeitige (und auch vor dem Tode) irreparable Degeneration des Gehirns festgestellt.
Demnach seien bei den Betroffenen Nervenzellen abgestorben und die Zahl der Verschaltungen zwischen Nervenzellen habe deutlich abgenommen. Kurz: Das komplexe Netzwerk der Zellen im Gehirn werde beeinträchtigt oder sogar teilweise zerstört. Darüber hinaus möchte uns seit der jüngeren Vergangenheit der Autor Nicholas Carr mit seinem Buch „Wer bin ich, wenn ich online bin“ einreden, dass „bereits eine Onlinestunde am Tag erstaunliche neurologische Prägungen in unserem Gehirn“ bewirke (laut Klappentext).
So negativ wie Peter Praschl Mitte der Woche in der Welt würde ich das Buch nicht besprechen. Warum? Ich würde das Buch gar nicht besprechen, weil ich es gar nicht erst lesen würde – „mit einem Vorwort von Frank Schirrmacher“, der schon mit seiner eigenen Payback-Denk-Apokalypse Panik verbreitet. Machen also Soziale Netzwerke unser Gehirn ebenso kaputt wie Drogen die gehirneigenen Netzwerke? „Die Generalthese vom potenziellen Hirnschaden durchs Internet“ erscheint laut Peter Praschl unbegründet. Ebenso undifferenziert erscheint mir die pauschale Beurteilung der Gehirne Drogentoter, ohne auf die dabei konsumierte Drogen zu verweisen (Heroin? – Kokain? – Cannabis? – Alkohol?).
Lesen kann bilden, Lesen kann aber auch nur Vorurteile zementieren. Nur Vorsicht, dass Lesen nicht zur Droge gerät und weitere neuronale, soziale oder sonstige Netzwerke zerstört.