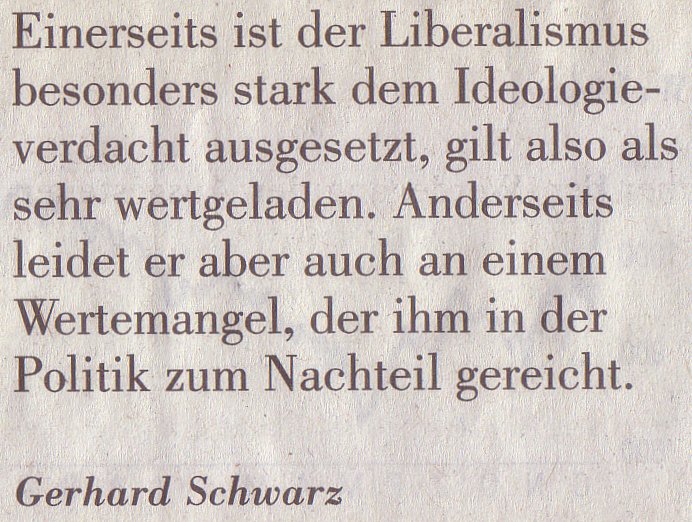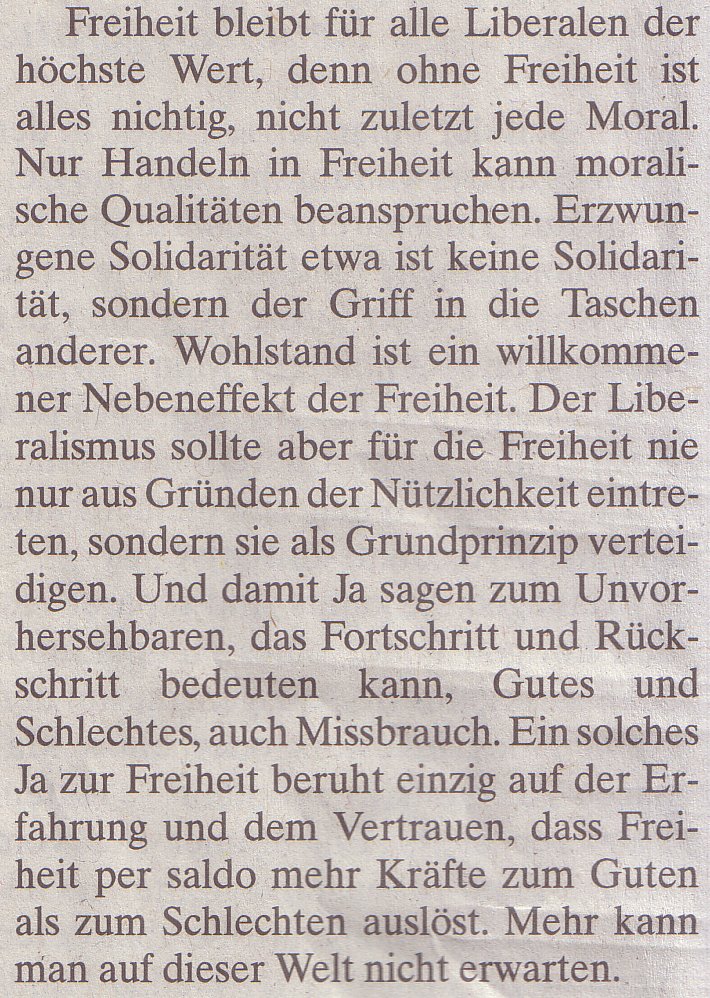Die NZZ hats mir angetan, ich habe es erst jüngst erwähnt. Vor allem der Blick aus dem Ausland auf die Kultur des deutschen Sprachraums empfinde ich als äußerst belebend, nicht nur im Feuilleton, sondern Anfang der Woche auch im Wirtschaftsteil. Gelegentlich erwacht aber doch ein Wille zum Widerspruch. Gerhard Schwarz, Leiter der Wirtschaftsredaktion und stellvertretender NZZ-Chefredaktor (wie es schweizerisch so schön heißt), hat am vergangenen Wochenende den Preis der Stiftung für abendländische Kultur und Ethik erhalten. Das war der NZZ im Wirtschaftsteil immerhin eine ganze Seite wert. Das klingt schon ein wenig eitel oder rechtfertigend.
Zu lesen sind vier Spalten Auszüge aus der Rede des Geehrten und eine Spalte aus der des honorigen, aber doch wegen Steuerhinterziehung 1987 verurteilten und damit vorbestraften Laudators Otto Graf Lambsdorff. Seine Laudatio ist betitelt: „Schockresistent liberal“; darin beschreibt er Gerhard Schwarz als geradlinig und dergestalt, „dass er auf den Vorwurf des kleingeistigen Dogmatismus fast gekränkt reagieren kann“. Schwarzens Redebeitrag ist überschrieben:
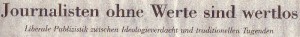
Fraglos basieren gute journalistische Texte auf gewissen tradierten Werten. Das sind Werte einer Grundordnung, denen sich vermutlich die Mehrzahl aller Journalisten gemeinschaftlich verpflichtet fühlen, wie Toleranz, Verantwortung und Rechtschaffenheit. Daneben stehen handwerkliche Werte wie etwa der Grundsatz einer neutralen – vorrangig nicht wertenden – Berichterstattung, das Prüfen von Aussagen, das Anhören einer Gegenseite und sicher auch das Ausrichten an einer Theorie.
Letzteres stellt die Neutralität der Berichterstattung jedoch bereits in Frage – sofern nicht auf die Möglichkeit hingewiesen wird, dass auch andere Theorien möglich sind, um einen Zugang zum Geschehen und eine Interpretation desselben zu erlangen.
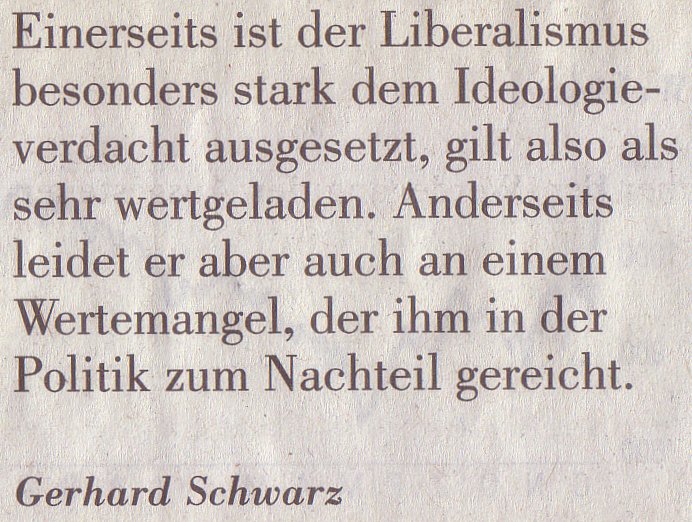
Was soll aber bedeuten, gegen den Liberalismus werde häufig die Ideologiekeule geschwungen? Liberalismus IST eine philosophische, ökonomische und politische Ideologie, die die individuelle Freiheit als normative Grundlage der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung anstrebt. Sofern Liberalismus im Sinne der aufklärerischen philosophischen Definition als Synonym zu einer pluralistischen Demokratie aufgefasst wird, bekenne ich mich auch zum Liberalismus, vor allem im Gegensatz zum Totalitarismus.
„Liberale Publizistik“ verschreibt sich damit vor allem dem Grundprinzip der Meinungsfreiheit. Wenn Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft die Ursprung der Moral im freien Willen verortet, so ist gerade das Moralische in einer liberalen Publizistik sicherlich angebracht. Vor allem im Feuilleton kommt dem Journalismus nach meiner Auffassung die „Kernkompetenz der Vernunft“ zu, Urteile zu fällen. Je nach Gesichtspunkt lassen sich für unterschiedliche Urteile zum selben Sachverhalt gute und bessere Argumente finden.
Liberale Publizistik findet als feststehender Begriff hauptsächlich Verwendung in historischen Zusammenhängern wie dem späten Kaiserreich, der Weimarer Republik und im Zusammenhang mit einer Unterstützung der Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards in der FAZ und der NZZ zwischen 1948 und 1957 . Doch das ist kein Grund, die liberale Publizistik auch heute als eine wertkonservative Einrichtung zu betrachten, wohl möglich mit der Absicht, nur ja den eigenen Status Quo zu erhalten.
Gerhard Schwarz schwankt zwischen einer Auffassung des Liberalismus als eine „positive Vision“, Zitat „wie Erhards <<Wohlstand für alle>> nach dem Zweiten Weltkrieg“ und der als „Grundprinzip“, das „für die Freiheit nie nur aus Gründen der Nützlichkeit“ eintritt.
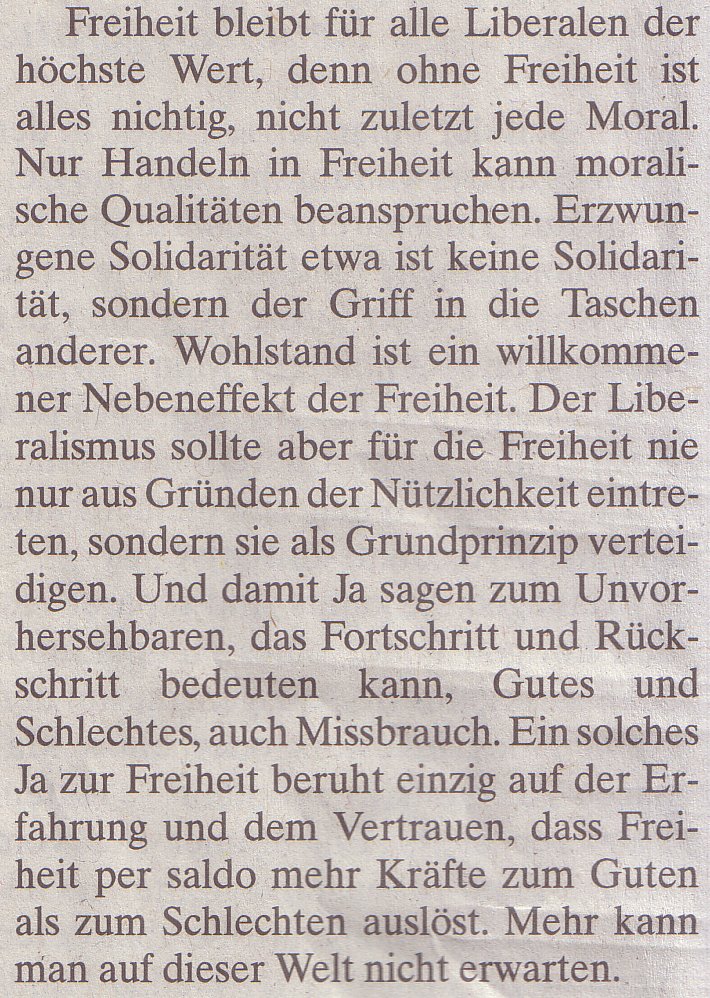
Die Rationalität des Liberalismus, so Schwarz, überfordere viele Menschen, gleichzeitig gebe er der Politik keine Werte vor – außer eben dem der Freiheit. Für einen Liberalen bedeutet in seinen Augen der Begriff Freiheit eine „Freiheit von…“ (z.B. Gewalt, Unterdrückung, Angst und Schrecken) und nicht als „Freiheit zu…“ (z.B. Selbstverwirklichung, Meinungsäußerung, Übernahme von Verantwortung und Engagement). Beides scheint mir aber unauflösbar miteinander verbunden, so wie in der Gesprächsführung das „Warum?“ nach den Gründen fragt und das „Wozu?“ nach den Lösungen.
Dass das „Ja zur Freiheit“, sprich das Bekenntnis zum Liberalismus einzig auf der „Erfahrung und dem Vertrauen (beruht), dass Freiheit per saldo mehr Kräfte zum Guten als zum Schlechten auslöst“, erscheint mir als Begründung etwas dünn. Wenn es eine Vision gibt, besteht da vielleicht doch auch ein Idealbild, auf das hinzuarbeiten es sich lohnen könnte? Ja sagen zum Unvorhersehbaren ist das Eine, das Andere aber auch Nein sagen zum Vorhersehbaren. Da verlangt die Publizistik Klartext, wie es jüngst zum Beispiel Rainer Hank in der FAZ mit seiner Analyse „Das Elend der FDP“ gemacht hat, in der er ihr „sozialdemokratischen Klientelismus“ vorwirft. En passant wird hier der Liberalismus als „kalt, herzlos und sozial ungerecht“ charakterisiert.
Genau das ist er auch in der Publizistik, wenn in der Berichterstattung lediglich Werte zur Anwendung gelangen, die der Tradition das Wort reden, wenn die Vorstellung einer gerechteren Gesellschaft in den Werten keinen Platz findet. Die Tatsache, dass sich Werte ebenso wie die Sprache und die Gesellschaft laufend fortentwickeln, ist für mich der Hauptgrund, warum ich mit wertkonservativen Liberalen wenig anfangen kann.