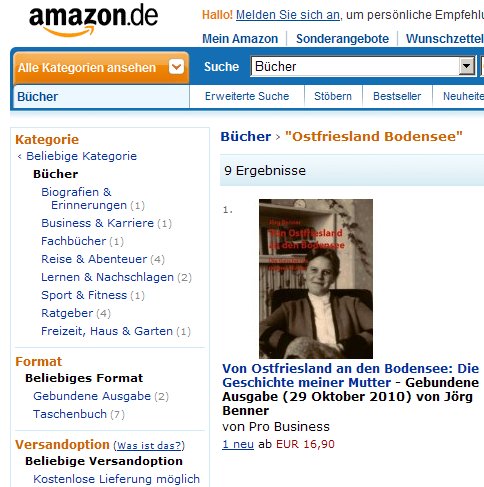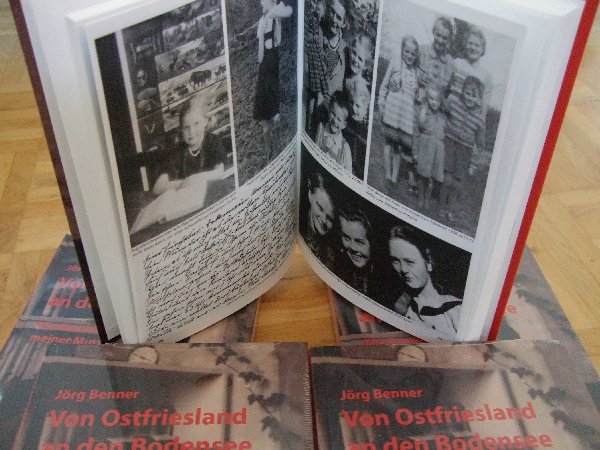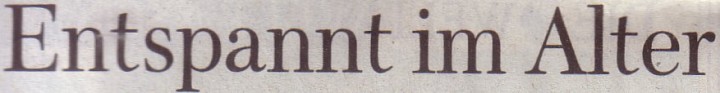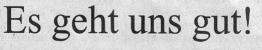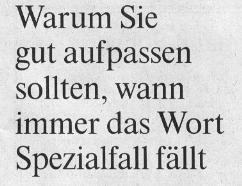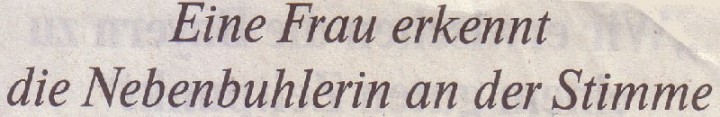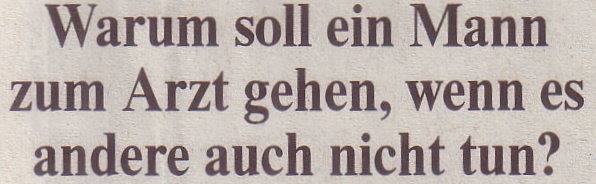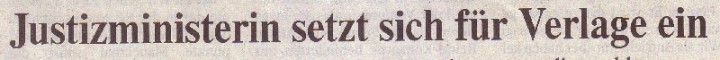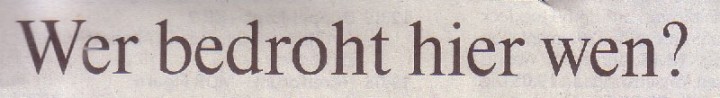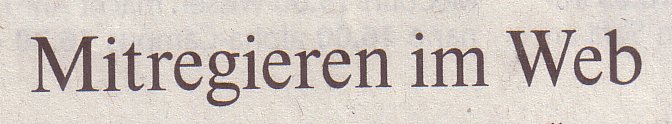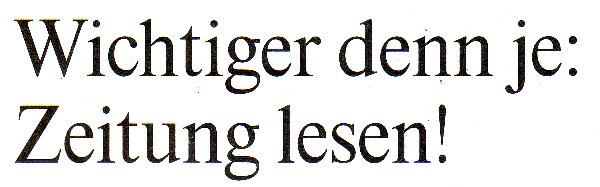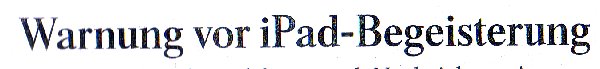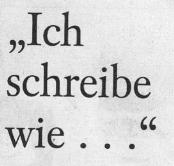Der 11. November oder „der Elfte im Elften“ wie rheinisch-jecke Frohnaturen sagen, hat ja durchaus verschiedene Bedeutungen: Die fünfte Jahreszeit wird eingeläutet, der Martinstag wird gefeiert zu Ehren des Heiligen Martins, der seinen halben Mantel einem frierenden Bettler gab, daneben zählt der Tag als Abschluss der Ernte, wo bei der Ernte auch fahrenden Scholasten schon mal von der frisch geschlachteten Gans oder vom angezapften Wein etwas abgegeben wird. Nun aber wiederfuhr mir an diesem Tag folgende Meldung aus der Welt:
Da war ich mir noch nicht ganz sicher, was jetzt kommt. Denn meistens, wenn eine PR-Agentur einen Text oder in Foto frei zum Adruck versendet, dann will sie ja, dass ich ihre Botschaft aufgreife, mich instrumentalisieren lasse und womöglich unfreiwillig Werbung für ewtas mache, hinter dem ich gar nicht stehe. Doch nicht hier: „Das brandenburgische Oberlandesgericht springt der Kunstfreiheit bei: Schriftsteller dürfen Zeitungsartikel auch ohne Genehmigung in eigenen Werken abdrucken“, heißt es da.
In diesem Fall hatte die „Märkische Oderzeitung“ gegen einen früheren Gerichtsdirektor aus Eisenhüttenstadt geklagt, der sich in seinem Buch „Blühende Landschaften“ kritisch mit der Rolle der Presse nach der Wiedervereinigung auseinandergesetzt und dazu auch Zeitungsartikel verwendet hatte. Eine Druckerlaubnis sei nicht notwendig, hieß es weiter und zur Begründung: „Die künstlerische Freiheit dürfe nicht dadurch eingeschränkt werden, dass die Wahl der Gestaltungsmittel von einer Einwilligung der Rechteinhaber abhängig gemacht werde.“ Hiermit erledigt. Bin ich deswegen nun Literat?