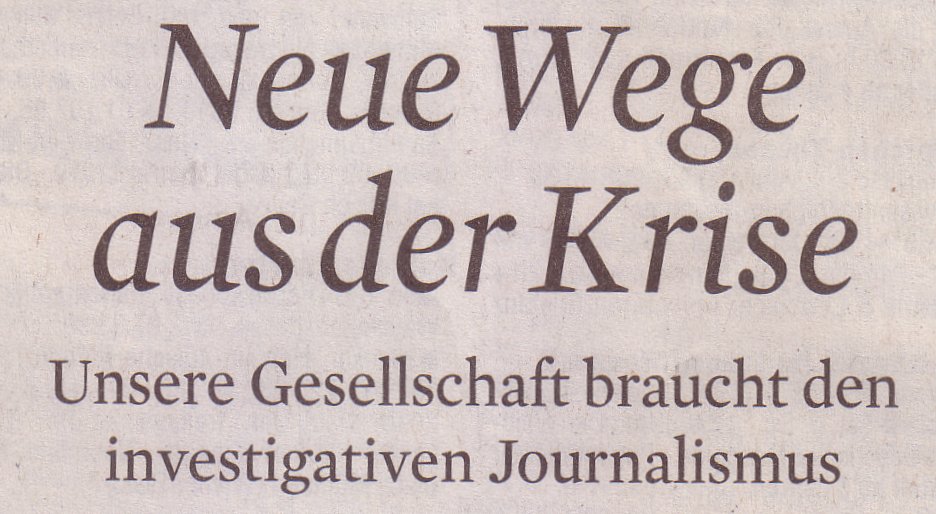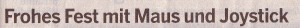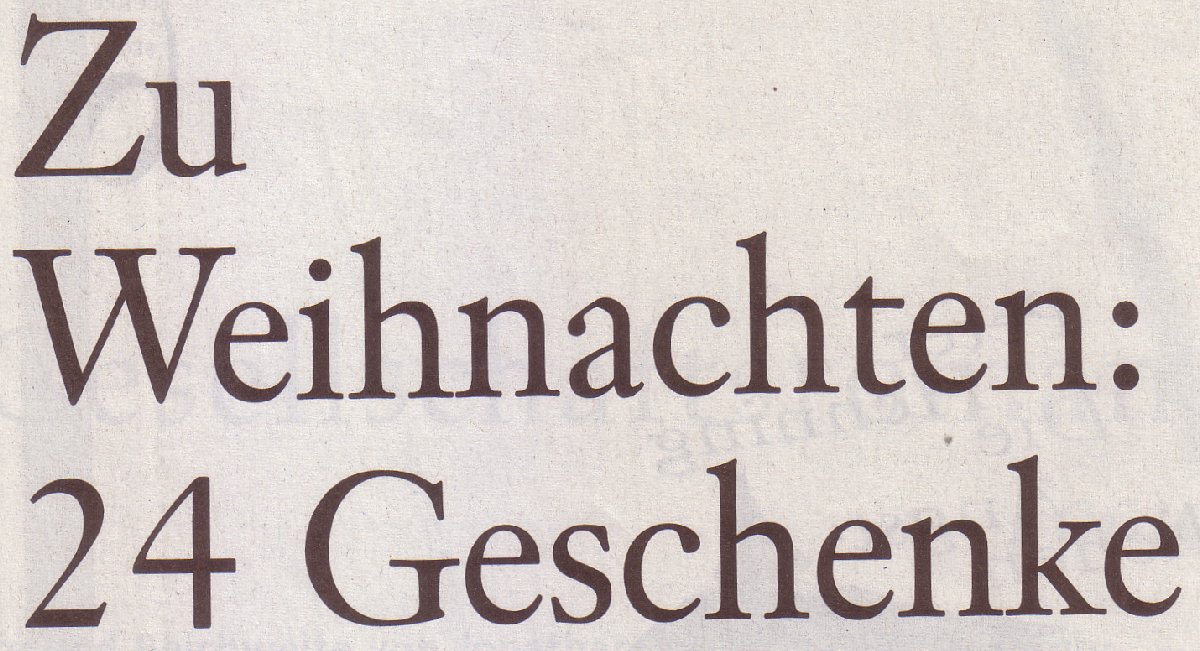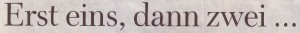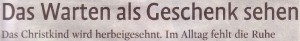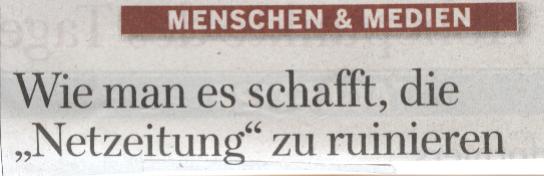Verleger Konstantin Neven DuMont im Kölner Stadt-Anzeiger und in der Welt am Sonntag. – Sören Kittel hat im Springerblatt den Verlegersohn befragt, der seit Januar des Jahres Vorstand der Mediengruppe DuMont ist und Herausgeber von Kölner Stadt-Anzeiger, Express und Mitteldeutsche Zeitung, seit diesem November auch Herausgeber der Frankfurter Rundschau. Der Titel „Kein Blogger schickt Reporter nach Afghanistan“ spricht mich als Blogger natürlich an. Die Aussage aus dem letzten Drittel des Gesprächs dient dem Befragten jedoch eher als Vergegenwärtigung seiner eigenen Position als Geschäftsmann.
Weitaus interssanter ist seine Stellungnahme zur Netzeitung, immerhin hatte die WamS dem Verlagshaus noch vor einem Monat vorgeworfen, die Netzeitung ruiniert zu haben (texthilfe.de hatte berichtet). „Das Geschäftsmodell hat einfach überhaupt nicht funktioniert“ wird Konstantin Neven DuMont zitiert, die Zweitverwertung wie beim Online-Auftritt einer Zeitung habe gefehlt. Die Online-Personalkosten zu refinanzieren habe die vergangenen Jahre über nicht geklappt, räumt er ein, zeigt sich aber zuvor überzeugt, das Problem fehlender Erlöse liege nicht am Internet: „Es ist ein Problem des fehlenden Geschäftsmodells.“
Hinlänglich bekannt ist, dass eigentlich erst das Anzeigengeschäft den Qualitätsjournalimus ermöglicht (vgl. texthilfe.de) und somit auch das qualitativ hochwertige Textumfeld im Internet qualitativ hochwertige Werbung ermöglicht. Bezahlmodelle im Internet funktionieren bisheriger Erfahrung nach nur in Special Interest-Bereichen, vielleicht auch im populärwissenschaftlichen. Über die Zahlungsbereitschaft der potenziellen Kunden scheint der Verleger jedoch keine genaue Vorstellung zu haben, aufgrund der vielen unterschiedlichen Studien: „Mal sind es zehn Prozent, mal 60 Prozent.“ Als Strategie seines Medienhauses gibt er „Qualität“ an und als Vision seiner verlegerischen Tätigkeit „gesellschaftspolitische Meinungsbildung“, „dazu brauchen wir Qualitätjournalismus“.
Auf das Gerücht aus der Süddeutschen Zeitung, dass der Verlag plane, Wirtschaft- und Politikressort seiner renommierten Tageszeitungen zusammenzulegen, wird er allerdings nicht angesprochen. Jedoch schreibt er tags zuvor selber in seinem Blatt Kölner Stadt-Anzeiger über „Neue Wege aus der Krise“ und plädiert dabei einmal mehr für investigativen Journalismus. Dieser setze „die Kräfte frei, die eine Gesellschaft zur Selbstreinigung benötigt.“
Dass der Umbruch der Medienlandschaft diesen wertvollen Journalismus gefährdet, stimmt, wenn das Geschäftsmodell fehlt. Dass aber der investigative Journalismus „immer mehr zwischen die Fronten eines wachsenden Kostendrucks bei bedrohten klassischen Erlösmodellen auf der einen und der Jagd nach Sensationen und sich stets erneuernden Schlagzeilen auf der anderen Seite“ gerate, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Zugegeben wächst der Kostendruck, zugegeben wächst auch die Zahl der Verbreitungswege. Aber befindet sich guter Journalismus nicht schon immer in dieser Gefahr?
Am Ende seines Beitrags in eigener Sache rückt Konstantin neven DuMont mit seinem Anliegen heraus: Sein Verlag entwickele „gerade Konzepte, den Anteil investigativer Reportagen in seinen Blättern zu erhöhen“. Zudem werde eine Vermarktungsplattform für Bezahlinhalte auf den Weg gebracht. „Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, hochwertige journalistische Inhalte nicht länger im Internet zu verschenken.“ Ohne die Zahlbereitschaft der Surfer einschätzen zu können, ein gewagtes Unterfangen. Da fürchte ich ja eher um den Einsatz. Wie hat es der Kollege Jürgen Oehler in derselben Zeitung vor sechs Wochen anlässlich des Münchner Print-Gipfels so schön auf den Punkt gebracht:
„Aber es gibt auch die Erkenntnis, dass der Bereich der zukünftigen Bezahlinhalte realistischer Weise klein ist. Denn keiner kann einfach einen Hebel umlegen und erklären, dass der Online-Nutzer ab sofort für all das bezahlen muss, was er bisher umsonst bekommen hat. Auf die Frage, ob er denn für Online-Inhalte Geld ausgeben würde, antwortete der Kölner Psychologe und Gastredner Jens Lönneker vom Rheingold-Institut. „Eigentlich nicht, aber vielleicht.“ Und das ist eben das Problem.“