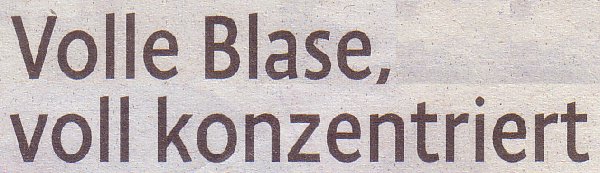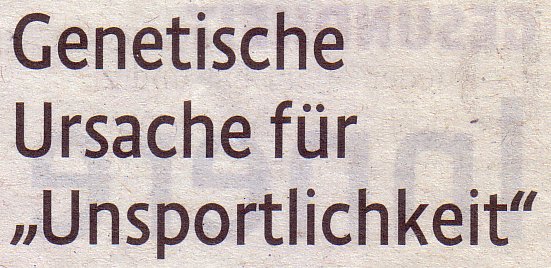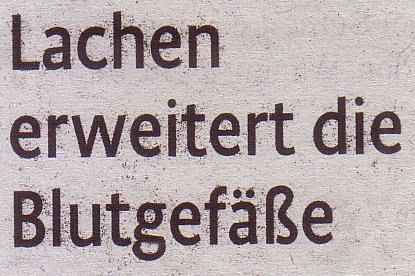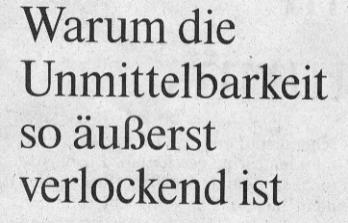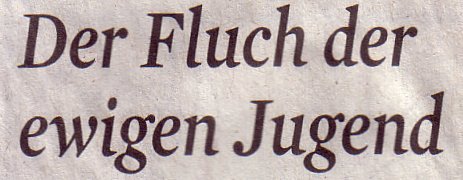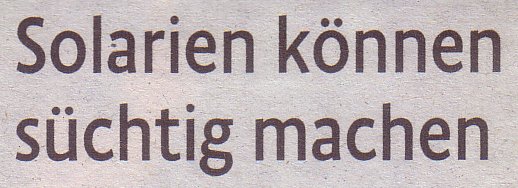Zuerst hielt ich die Überschrift für eine Aufforderung, Kölner sollen doch bitteschön am besten im eigenen Bundesland bleiben, da sie sich dort einfach am wohlsten fühlen. Erst beim Weiterlesen bemerkte ich, es handelt sich um die Aussage einer Super-Statistik.
Die Deutsche Post hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch das Auswerten von Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Statistischen Bundesamts (nicht zu verwechseln mit einem buddhistischen Standesamt) und des Instituts für Demoskopie Allensbach herauszufinden, wie glücklich die Deutschen im Besonderen und im Allgemeinen sind. Der „Glücksatlas 2011“ teilt Deutschland in 19 Regionen auf, wobei die Kölner Region auf Platz 9 noch vor der Düsseldorfer (PLatz 12) und Westfalen (Platz 13) liegt.
Am glücklichsten sind demnach die Hamburger, wozu der Studie zufolge hohes Pro-Kopf-Einkommen, kulturelle, sportliche und soziale Aktivität, eine junge Altersstruktur und eine positive Mentlität beitragen. Der Kölner an sich, oder der Rheinländer führt hingegen die Wertungen bei der Zufriedenheit mit der Gesundheit, mit der Arbeit und mit dem Einkommen an. Allerdings herrscht in meiner Heimatregion auch die bundesweit höchste Ungleichheit und jeder Dritte leidet unter Stress.
Im Großraum Düsseldorf ist hingegen nur eine Kennzahl überdurchschnittlich, nämlich das Einkommen – sofern dem nicht, wie im westlichen Ruhrgebiet, eine überproportionale Arbeitslosigkeit entgegensteht. Hinzu kommen Unzufreidenheit mit der Arbeit und mit der Gesundheit. Das zeigt weieder einmal: Geld macht nicht glücklich – und Alt trinken kann auf Dauer nicht gesund sein 😉
Schlusslicht in der Gesamtwertung des Glücksatlasses ist die Region Brandenburg, wo trotz rückläufiger Arbeitslosigkeit das Pro-Kopf-Einkommen relativ niedrig ist, die Alterung noch schneller voran schreitet als anderswo und vergleichsweise wenig soziale Kontakte gepflegt werden. Insgesamt jedoch herrscht deutschlandweit die höchste Zufriedenheit seit zehn Jahren, wobei der Norden statistisch zufriedener ist als der Süden und der Osten deutlich unzufriedener als der Westen. Allerdings habe sich diese „Glückslücke“ verringert, heißt es, und nur zehn Prozent der Deutschen seien „richtig unzufrieden“.