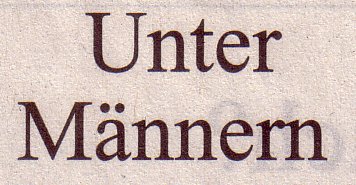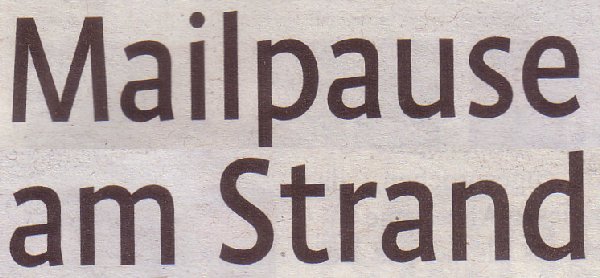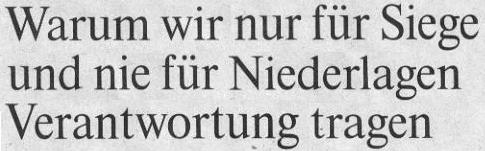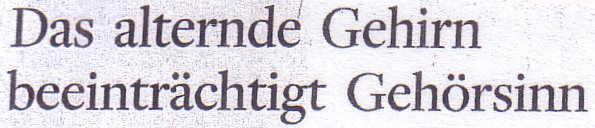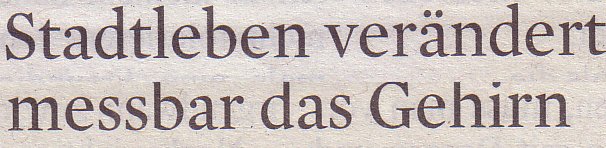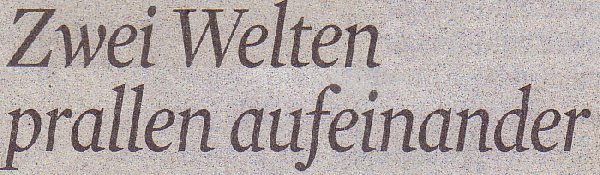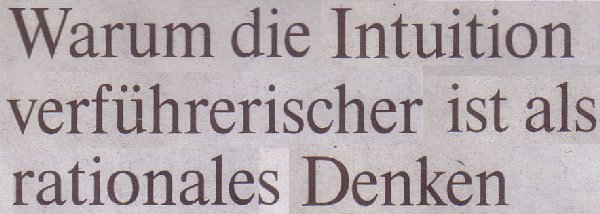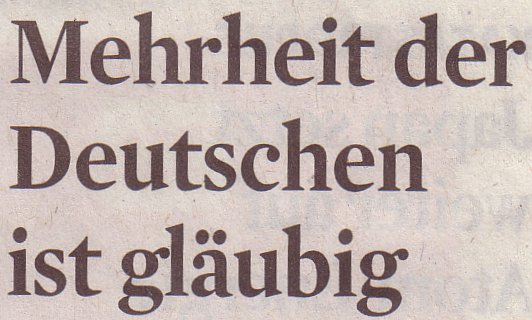Erst gestern hatte ich an dieser Stelle die modernen Berufsbilder in einer Online PR-Agentur bestaunt. Da lässt sich noch eine andere Betrachtung anschließen, ebenfalls aus der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende: Wer weit nach oben kommen möchte, muss offenbar schlechte Charaktereigenschaften haben. Das ist der Tenor des oben verlinkten Artikels, der unter diesem Titel in der Printausgabe erschien:
US-Psychologen der Norte Dame University in Indiana haben vier Studien miteinander verglichen und sind zu dem Schluss gekommen: „Wer nett ist, verdient weniger und wird seltener für Managementposten vorgeschlagen.“ Das Ergebnis haben sie im aktuell erscheinenden Journal of Personality und Social Psychology veröffentlicht.
Die weniger freundlichen Männer sind in Verhandlungen effektiver und erreichen mehr. Frauen dagegen können sich anstellen wie sie wollen, ihre Gehaltssteigerungen sind nicht signifikant und sie verdienen sogar als böse Biester noch deutlich weniger als die nettesten Männer. Gleichzeitig müssen Frauen, die sich knallhart geben, üble Nachrede fürchten. Dadurch würden sie, wie es weiter heißt, zu der „zwiespältigen Kommunikation“ gezwungen, klare Fordungen hart, aber freundlich zu verfolgen.
Die Freundlichkeit im Berufsleben hört vermutlich immer dann auf, wenn es ernsthaft um geschäftliche Belange geht. Sollte ich da charakterlich vielleicht sogar ein wenig stolz auf mich sein, mich als Loser zu fühlen? Dazu fällt mir Bert Brechts Ballade „Über die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“ ein, worin es gegen Ende so passend heißt:
„Wir wären gut – anstatt so roh,
doch die Verhältnisse, sie sind nicht so“