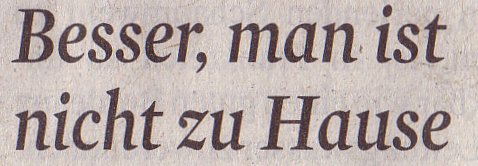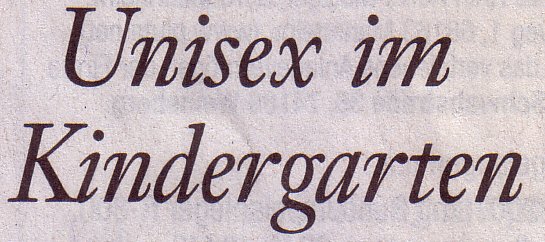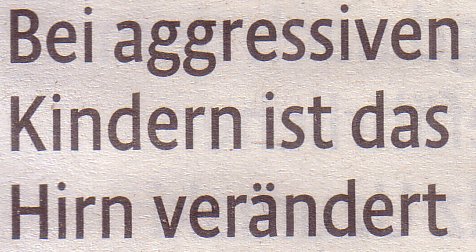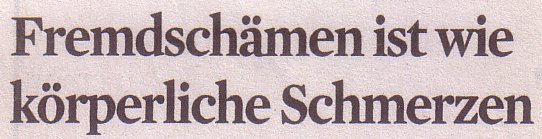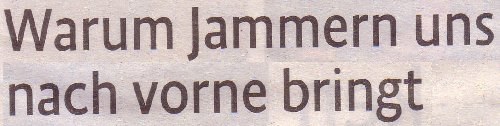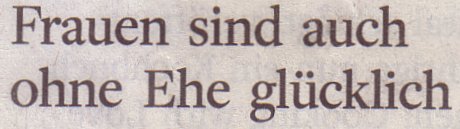Erstaunlich, was die lebendige Forschung dieser Tage alles ans Tageslicht befördert. Einer repräsentativen GfK-Umfrage zufolge finden fast zwei Drittel der Befragten das ausführliche Berichten über körperliche Leiden furchtbar. Das hat der Kölner Stadt-Anzeiger jüngst berichtet. Das ist vielleicht nicht ganz überraschend, hat aber doch einige Konsequenzen für den täglichen Small-Talk.
Schon die allseits beliebte Frage „Wie geht’s?“ sollte daher vermieden werden, da sie für chronisch Kranke doch leichterdings als Aufforderung zum ausführlichen Bericht verstanden werden. Im englischsprachigen Raum, vor allem in den USA, ist die entsprechende Frage „How are you?“ längst entsprechend sinnentwertet. Niemand erwartet hier eine ausführliche Antwort, allenfalls eine höfliche Rückfrage wie „Fine, and you?“.
Demgegenüber gelten Europäer (um das Klischee zu bedienen) doch als tiefsinniger oder kultivierter. Bei der Frage nach dem werten Befinden ist daher eine Antwort wie „Ich kann nicht klagen“ im Sinne von „beschissen, aber das müssen wir hier nicht vertiefen“ empfehlenswert. Offenbar tendieren aber doch mehr als genug Zeitgenossen dazu, den eigenen Gesundheits- oder Krankheitszustand über Gebühr darzustellen. Vielleicht liegt es daran, dass viele Leute sich einfach zu wichtig nehmen.
Was die Gesundheit (die eigene oder die von Fremden) betriftt, scheiden sich einfach die Geister. Die einen kriegen nicht genug davon, zu erfahren, wie der Körper funktioniert oder warum er es egarde nicht tut. Andere fühlen sich mehr oder weniger unangenehm berührt, wenn sie nur von einer Krankheit anderer hören (dazu muss man nicht ein Hypochonder wie Jerry Lewis im Film „Der Tölpel vom Dienst“ sein). Vielleicht daher die oft kurz gehaltene Antwort: „Frag nicht!“