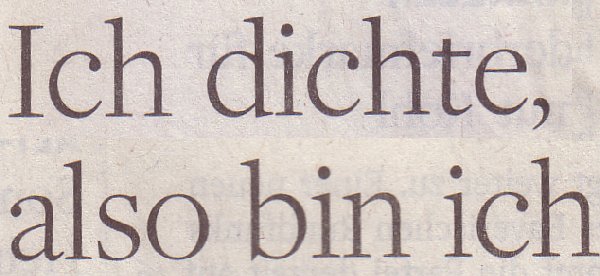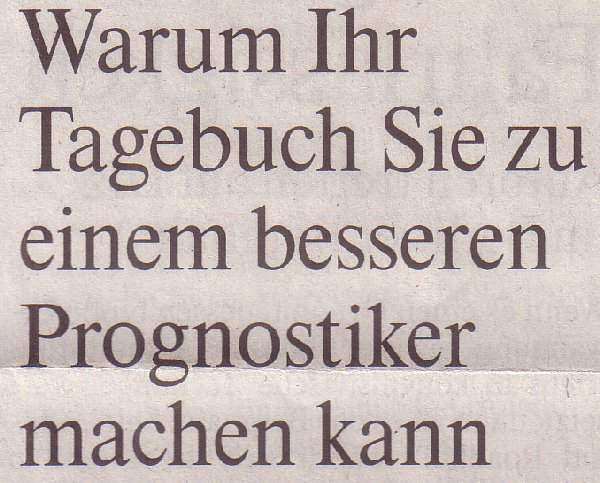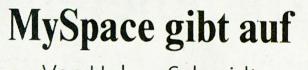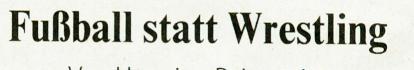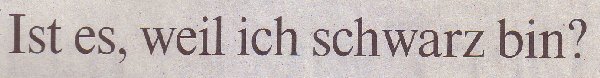Im Kampf gegen mich selbst kann ich nur bestehen, wenn ich mir eine Chance gebe. Was ich damit sagen will, ist: Wenn es darum geht, eine Prüfung zu bestehen, vor der ich mich wohl möglich fürchte, muss ich immerhin dazu antreten. Ihr fernzubleiben, bringt mich in Sachen menschlicher Reife nicht weiter. Für das Angehen einer ungeliebten Prüfungssituation haben Wissenschaftler jetzt jedoch Hilfe in Aussicht gestellt.
Zwei US-Wissenschaftler von der University of Chicago berichten laut Rheinischer Post im Fachmagazin „Science“ darüber, dass ein „sich-die-Prüfungsangst-von-der-Seele-Schreiben“ tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt. Wie im gestrigen Eintrag legt das den Schluss nahe: Wer schreibt, der bleibt! Doch bei dem gewöhnlich mit Prüfungen verbundenen Lernstress musst du natürlich erst mal die Zeit finden oder dir nehmen, um dich derart selbst zu thearpieren.
Demnach hilft diese Methode vor allem bei Leuten, die große Prüfungsangst haben. Kleine Ängste finden dabei also offenbar weniger Linderung. Schön ist aber, dass die allermeisten Ängste – und bevorzugt Prüfungssituationen – gerne auch wieder in Träumen auftauchen. Träume scheinen überhaupt ein psychischer Ort zu sein, der für den Reifeprozess des Menschen eine fast ebenso große Rolle spielt wie Prüfungen.
Darum lieben wir ja auch Computerspiele so: Es handelt sich oft um eine Abfolge von Prüfungen, die wie im Traum vorüberziehen. Wir stellen uns diesen Prüfungen (vielleicht auch den damit verbundenen Ängsten) immer und immer wieder, bis wir es schaffen. Ob aber Computerspiellevel zu bestreiten, vor deren Bewältigung ich mich fürchte, etwas zur Minderung der Prüfungsangst beitragen kann, wurde nicht untersucht.
Suggestion oder Autosuggestion ist da meiner Erfahrung zufolge oft die beste Medizin. Ich sage mir immer wieder: „Ich weiß, Du schaffst es!“ – so, wie es früher meine Eltern mir sagten, wenn es um unliebsame Aufgaben ging. Vielleicht kommt das dem Herunterschreiben der eigenen Ängste schon sehr nahe.