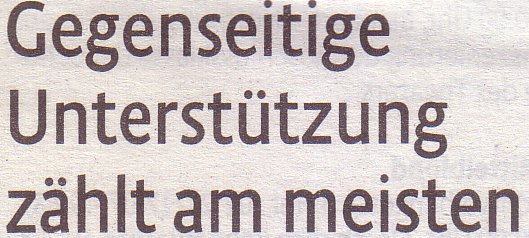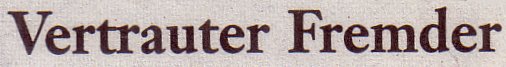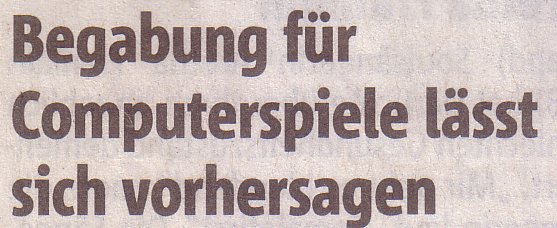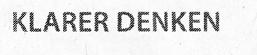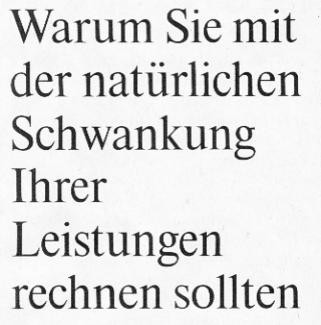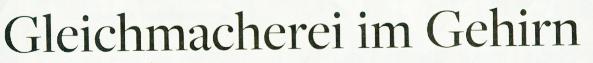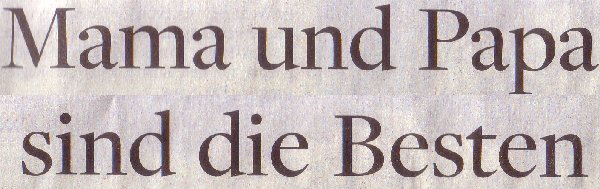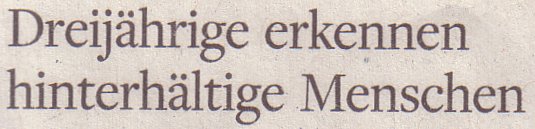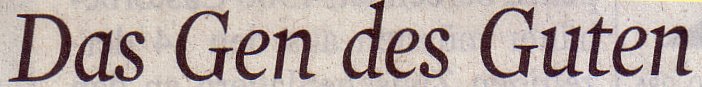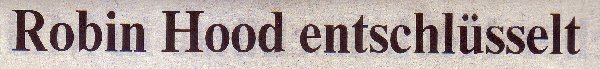Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact beschäftigt sich mit den Bedingungen einer glücklichen Partnerschaft. Als Top-Antwort gaben mehr als drei Viertel der Befragten an,
Die beliebtesten Antworten danach waren Kompromissbereitschaft (66 %), ständiger Austausch sowie Gleichberechtigung (je 50 %). Finanzielle Aspekte schnitten bei der Befragung dagegen als vergleichsweise sehr unwichtig ab (um die 10 Prozent). Während Männer demnach ein erfülltes Sexleben mit 45 % für weit wichtiger als Frauen halten (32 %), sheen Frauen umgekehrt in der Konfliktfähigkeit (46 %) ein weit stärkeres Kriterium für Partnerglück als Männer (36 %).
Kann es sein, dass der Begriff „Unterstützung“ so stark abgeschnitten hat, weil es reichlich schwammig, das heißt alles und nichts bedeuten kann? „Ständiger Austausch“ klingt demgegenüber schon nachvollziehbarer, auch wenn es ein wenig bedrohlich wirken könnte. „Gleichberechtigung“ allerdings scheint mir nur ein frommer Wunsch zu sein, immerhin leben Beziehungen doch ganzklar von (teilweise wechselnden) Positionen der Stärke und Schwäche. Aber auch, wenn damit gemeint wäre, dass jeder abwechselnd einmal stark und schwach sein darf, entspricht das so vermutlich nur sehr selten der Realität.
Der Begriff, der mir neben einer „ausgeglichenen Gefühlswelt“ fehlt (ganz gleich, ob diese nun durch Sex oder Konfliktfähigkeit erreicht wird), ist „Bewusstsein“, was ich mit nachfolgendem Beispiel von Aretha Franklin aus dem Erfolgsfilm „Blues Brothers“ (mit chinesischer Untertitelung) verdeutlichen möchte.