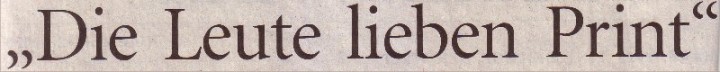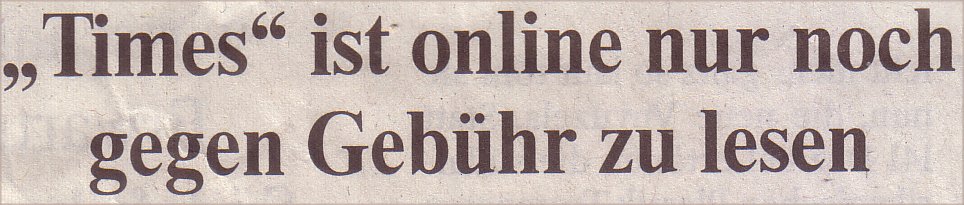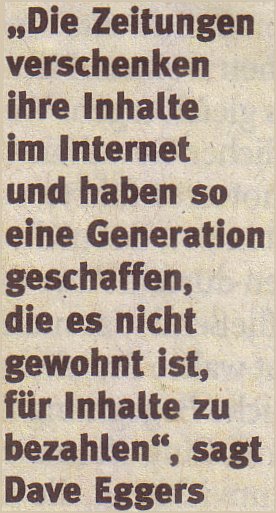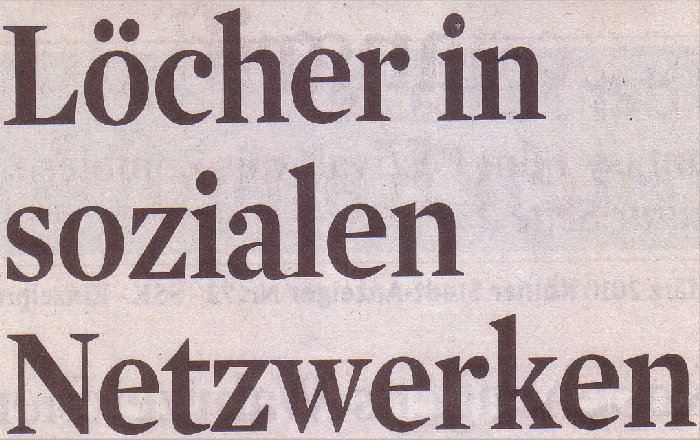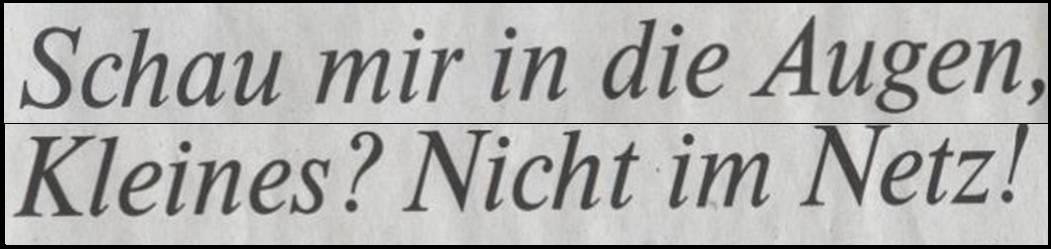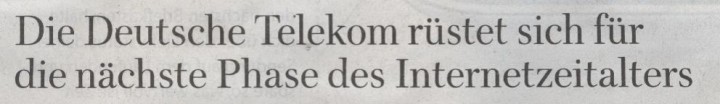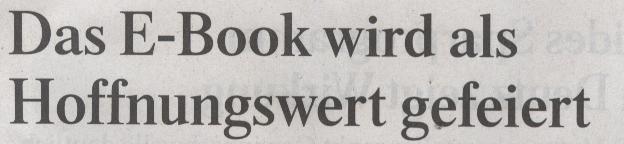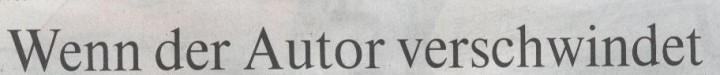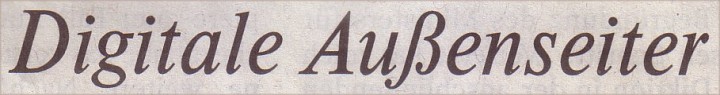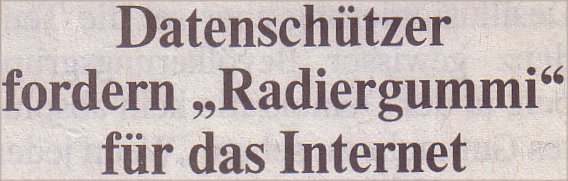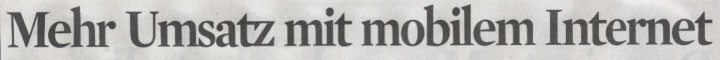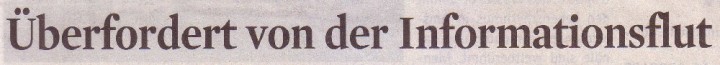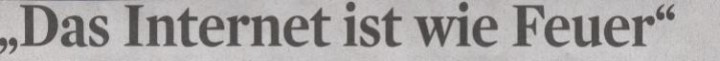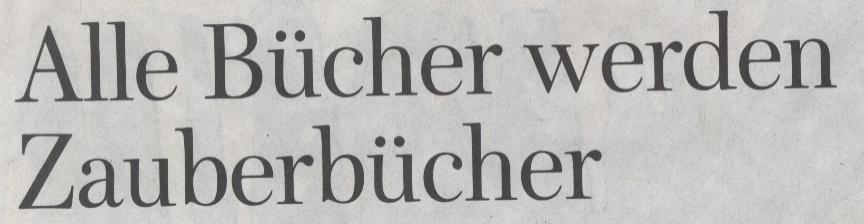US-Schriftsteller Dave Eggers stapelt im Welt-Interview mit Wieland Freund tief. Eingangs angesprochen auf den Vergleich mit Bono antwortet er: „Er steht auf einer Bühne, auf der wir Schriftsteller nie stehen werden. Wir sitzen immer in der Nische. Ich bin wahrscheinlich einfach der Typ, der jeden nervt.“ Das verbindet ihn doch wieder mit Bono, der auch schon gewaltig nerven kann. Dabei für sich und in der Sache sehr erfolgreich.
Dave Eggers hat neben mehreren journalistischen Romanen auch das Drehbuch zu „Wo die wilden kerle wohnen“ geschrieben, den alternativen Verlag „Mc Sweeney’s“ und das Bildungsprojekt „826 National“ gegründet. Tantiemen aus Verkaufserlösen steckt er wieder in gemeinnützige Projekte, weil er sagt: „Wir haben ein Haus, Geld zurück gelegt für das College der Kinder, alle haben anzuziehen und zu essen. Wenn dafür gesorgt ist, was dann?“ Sehr sympathisch, vor allem für einen erfolgreichen Autor und Unternehmer. Radikal neue Ideen, behauptet er, erreichten die USA (und vermutlich entsprechend auch andere Nationen) über ein Buch. Über Unwege kommt das Gespräch gegen Ende auf sein Verlegertum und den Buchmarkt zurück. „Die Leute lieben Print“ sagt Dave Eggers in diesem Zusammenhang, während er zu Hause keinen Internetzugang besitzt und sich nur durch Zeitungen informiert.
In diesem Zusammenhang der Einschub bezogen auf einen anderen Artikel aus derselben Zeitung, Die Welt, vom Freitag:
Der Konzern „News Corp“ baut aktuell sein kostenpflichtiges Angebot massiv aus. Die Kosten für Online-Nutzer der „Times“ belaufen sich auf ein Pfund pro Tag (etwa 1,11 Euro) oder zwei Pfund pro Woche, lediglich für Abonnenten der gedruckten Ausgabe bleibt der Online-Zugang kostenfrei. Die nicht mehr unbeschränkte Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Verlagsinhalten im Internet berührt den guten Dave Eggers nach diesem Modell so oder so nicht (erstens bevorzugt er Print und zweitens hat er vermutlich das eine oder andere Abonnement).
Neben der „Times“ und der „Sunday Times“ werden der Welt zufolge auch die Boulevardblätter „Sun“ und „The News of the World“ im Internet kostenpflichtige Artikel anbieten. Bisher hatten lediglich einige Wirtschaftszeitungen wie die „Financial Times“ und das „Wall Street Journal“ ihre Internetangebote kostenpflichtig gemacht. Die „New York Times“ wird 2011 folgen. Eine Frage der Zeit, bis auch die Verlinkung auf die Welt-Artikel wie in diesem Beitrag so nicht mehr möglich sein wird. Allerdings stimme ich Dave Eggers zu – um auf das Interview zurück zu kommen – dass die Kostenloskultur der Zeitungsverlage im Internet (selbst-)“zerstörerisch gewirkt“ hat. Daher bringt der Verlag McSweeney’s auch Zeitschriften heraus mit dem Anspruch, „besser zu sein, als sie es vor zehn oder 15 Jahren waren, als die Konkurrenz noch nicht so groß war.“