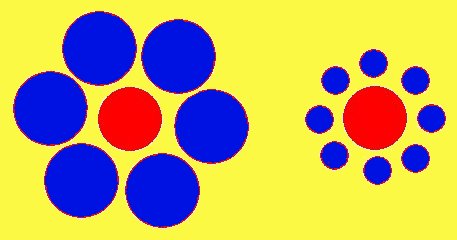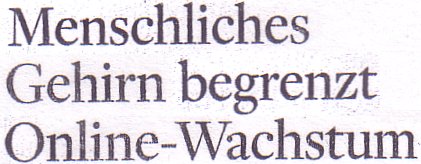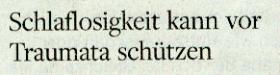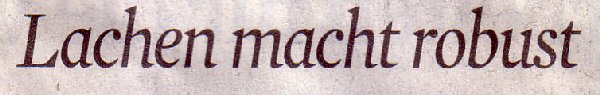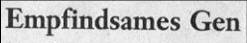Die Deutsche Presse-Agentur ist mit der Meldung zu einem psychologischen Versuch angekommen, die bereits vor vier Monaten so ähnlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonnatgszeitung stand (ich berichtete hier). Während sich der frühere Bericht auf das Quarterly Journal of Experimental Psychology bezog, ist der Bezugspunkt nun ein entsprechender Bericht in „Psychologie heute„. Mir war doch gleich so, als hätte ich das schon einmal gehört – bevor ich durch die Tür gegangen war…
Gabriel Radvansky von der US University of Notre Dame berichtet von einem Versuch, bei dem Probanden damit beauftragt wurden, einen Gegenstand zu holen. Bei gleicher zurückzulegender Distanz vergaßen deutlich mehr Teilnehmer, was sie wollten, wenn sie dabei eine Türschwelle passieren mussten. Der Gang durch einen Türrahmen, so die Schlussfolgerung des Forschers, befördert eine gewisse Art der Vergesslichkeit, die allerdings nicht weiter bedenklich ist. – So verstand ich den Versuch und schrieb dies bereits im November 2011.
Nun aber heißt es, das Gehirn kopple Gedanken häufig an das Zimmer, in dem er entstand (oder gefasst wurde, wie ich lieber sage). Grund hierfür sei, dass das Gehirn Erinnerungspkete bündle, die nicht unbedingt inhaltliche Aspekte zusammenfassen, sondern auch gänzlich „uninteressante“ Rahmenbedingungen wie die räumlichen Gegebenheiten. Entgegen dem möglicherweise verbreiteten Glauben, dass in so einem Fall die Rückkehr in den vorigen Raum helfe („in den Raum des Gedankens“ – ein sehr schöner Begriff), ist den Versuchsteilnehmern auch dann nicht wieder eingefallen, was sie vergessen hatten. „Einmal archiviert, seien die Gedanken nicht so leicht wieder abrufbar“, heißt es abschließend in der dpa-Meldung.
Es scheint also von Vorteil, besser für längere Zeit im (doppeldeutigen) „Gedankenraum“ zu bleiben oder aber sich flüchtige Gedanken aufzuschreiben, ehe sie dem Vergessen anheim geraten. Denn letztlich steckt hinter dem meisten Willen und der meisten Begeisterung doch ein entsprechender Gedanke, der nicht so schnell „weggeordnet“ werden sollte. „Behalte den Gedanken!“ lautet also die Botschaft, oder noch besser teile ihn, damit er sich weiter entfalten kann – wie der Amerikaner gerne sagt: „Spread the word!“